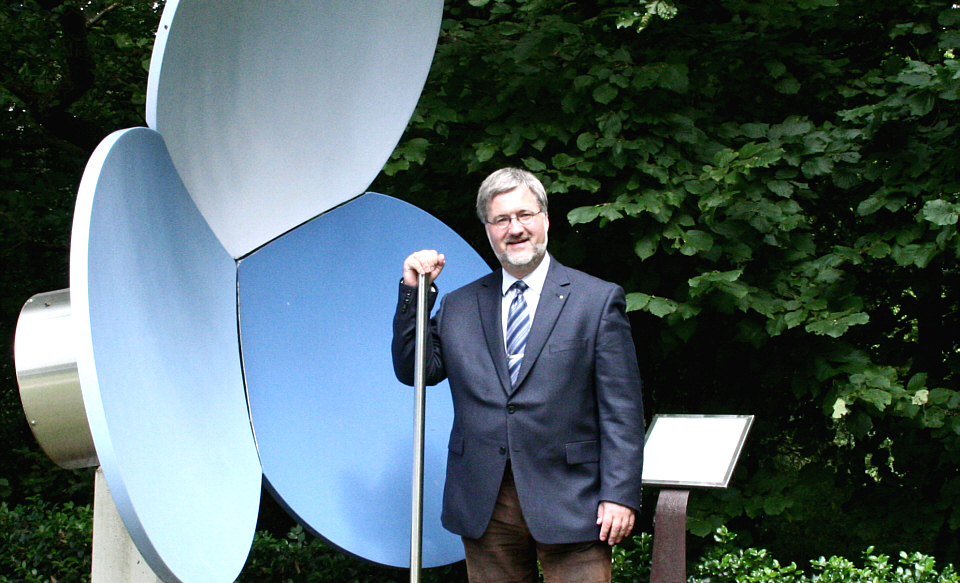“Gift im System”
Wer macht das Rennen im Wahlkreis 27? Der Lokalteil bittet die Direktkandidaten der Bundestagsparteien zum Gespräch – heute: Stephan Albani (CDU) über die Gesundheit, Haussanierungen und die Eignung von Schiebedächern als Türen.
Herr Albani, Sie erben die Direktkandidatur der CDU in diesem Wahlkreis von einem Parteikollegen, der in der Region recht prominent und populär ist, nämlich Thomas Kossendey. Macht das Ihre Kandidatur zu einem Selbstläufer oder eher schwieriger?
Es hat ein wenig von beidem. Auf der einen Seite ist es gut, dass Herr Kossendey und ich während meiner Kandidatur vieles gemeinsam gemacht haben und er mich auch sehr unterstützt hat und ich ja auch gerne lerne und an 27 Jahren Politerfahrung teilhaben möchte – es wäre ja Wahnsinn zu meinen, dass man so etwas nicht nötig hätte. Andererseits stellen sich die Leute dann auch schnell die Frage: Wo hört Kossendey auf und wo fängt Albani an? Ich denke aber, dass ich mir in den 16 Jahren, in denen ich das Haus des Hörens aufgebaut habe und vor allem in den letzten zehn Jahren, in denen ich vermehrt in Berlin tätig war, mir auch das eine oder andere habe aneignen können. Zumal ich ja keine typische Parteipflanze bin: Ich bin seit vier Jahren in der Partei tätig und bringe auch viele Anregungen von außen ein – und wir haben zusammen festgestellt, dass das auch seine Reize hat.
Sie sind Physiker – das haben Sie schon mal mit der Kanzlerin gemein – und als solcher an Wissenschafts- und Hochschulpolitik interessiert, die Sie auch zu Ihren Schwerpunkten zählen. Hätten Sie da nicht in Hannover mehr bewegen können als in Berlin?
Ich bin ja nicht in die Politik gegangen, um das zu tun, was ich hier schon mache. Die Überlegung entstand durch die vielen Jahre, in denen ich in Berlin in verschiedenen Gremien tätig bin – das ist im Laufe der Zeit immer breiter geworden: Am Anfang war es Hörforschung, dann Forschung und Bildung, dann Wirtschaftsleistung in der Region … Irgendwann ergab es sich dann in Gesprächen mit Parteifunktionären, dass sie sagten: Kommen Sie doch hierher und machen Sie Politik! Und nachdem die Entscheidung getroffen war, stellte sich die Frage, wo ich mich am sinnvollsten einsetzen kann. Das eine ist natürlich der Wissenschaftsbereich, in den ich einiges einbringen kann, das zweite ist der Unternehmerbereich – immerhin haben wir drei Unternehmen hier aufgebaut, auch wenn es eher kleine sind – und last but not least sind wir ja im medizinischen Bereich tätig.
Gesundheit, gutes Stichwort. Alle paar Jahre wird die große Reform angekündigt, heraus kommen allerdings eher Reförmchen. Und für die Patienten ändert sich zumeist nur, dass die Kosten steigen, die Leistungen aber zurückgefahren werden. Ein ziemlich dickes Brett, bei dem Sie da zum Bohrer greifen wollen.
Vor 30 Jahren haben wir festgestellt, dass wir im Gesundheitssystem Schwierigkeiten bekommen werden. Damals waren auf der einen Seite die Einnahmen der Kassen rückläufig, auf der anderen Seite wurde die medizinische Versorgung immer teurer. Ich sage dann immer: Freuen wir uns doch erstmal, dass wir alle soviel länger gesund bleiben. Es wird immer gesagt: Ohgottohgott, demografischer Wandel, Riesenproblem – aber daran haben wir doch Jahrzehnte gearbeitet. Also, erstmal kräftig freuen, dann an die Probleme rangehen. Da haben wir zwei Stellschrauben: Die eine ist die Verbesserung der Einnahmenseite. Das lief in den letzten Jahren aufgrund der Arbeitsmarktentwicklung ganz gut. Andererseits haben wir jetzt viele Jahre der Therapie des Gesundheitssystems hinter uns, in denen wir versucht haben, mit immer weniger Kosten immer mehr Leistung aus dem System herauszuholen – was dazu geführt hat, dass die Krankenhäuser, die Ärzte und die Therapieeinrichtungen an einem ganz gefährlichen Punkt stehen. All diejenigen, die ineffizient arbeiteten, sind in den letzten Jahren kaputtgegangen – jetzt müssen wir schauen, wie wir die Medizin in den nächsten Jahren betreiben wollen, was wir dafür ausgeben wollen und die nötigen Strukturen schaffen.
Ich sehe das als eine Art Chemotherapie: Weil es vor 30 Jahren schlicht undenkbar war, ein Krankenhaus zu schließen oder einen Fachbereich zu schleifen, hat man versucht, mit immer weniger Geld zu arbeiten. Damit bringt man Gift in das System; die ineffizient Arbeitenden gehen als erste drauf, die Gesunden halten länger durch. Aber wenn Sie nicht irgendwann die Chemo absetzen und anfangen, den Körper wieder aufzubauen, gehen irgendwann auch die Gesunden kaputt. Deswegen haben wir eigentlich keine Zeit mehr für viele „Reförmchen“. Und dass es teurer wird, ist eine Entscheidung der Gesellschaft: Wollen wir uns die Gesundheit etwas kosten lassen oder nicht? Wir können nicht per Verordnung entscheiden, dass eine medizinische Innovation nicht teurer sein darf als X. Wir können aber Wettbewerb zulassen, wie es bei den Pharmafirmen mittlerweile ja auch der Fall ist, wenn nach dem Auslaufen von Patenten Generika auf dem Markt Preisdruck erzeugen.
Ihr persönlicher Wahlkampfslogan lautet, passend zu Ihrer Profession: „Hören, zuhören – handeln“. Welcher Gruppe würden Sie denn im Falle Ihrer Wahl zuallererst einmal zuhören wollen?
Der Gruppe, der ich heute auch schon zuhöre: den Bürgern.
Hm. Geht das auch etwas spezifischer?
Ich führe mit den Leuten am Stand ja Gespräche über alles Mögliche, von der richtigen Einstellung medizinischer Geräte bis hin zur richtigen Einstellung ihrer Fritzbox. Ich höre gerne zu, wenn irgendwo der Schuh drückt, gerne auch in Bereichen, in denen ich nicht so viel Erfahrung habe wie bei meinen Kernthemen. Ich gehe in Unternehmen und Einrichtungen, spreche mit den Leuten höre mir die Probleme an und auch die Lösungsvorschläge – natürlich sind die oftmals sehr nischenbezogen. Aber darin sehe ich meine Aufgabe: Wie kann man aus diesen Partikularlösungen generelle Lösungen entwickeln? Es gibt also keine Gruppe, bei der ich sage: Denen höre ich jetzt mal als allererstes zu. Als Unternehmer weiß ich, dass es Auftraggeber und Auftragnehmer gibt. Und als gewählter Abgeordneter wäre ich Auftragnehmer für die Menschen in der Region.
Ich zitiere Sie einmal aus einem Wahlkampfvideo: „Wir müssen Deutschland modernisieren. Wir müssen viele Dinge umbauen, erneuern, verändern“ – als Metapher diente Ihnen die Sanierung eines Hauses. Nun wird der Regierung Merkel in den sieben Jahren ihrer Regierungsverantwortung ja eher das Gegenteil nachgesagt, nämlich eine gewisse Scheu vor allzu großen Veränderungen. Möchten Sie auch deswegen nach Berlin, um Ihren Parteigenossen in den Allerwertesten zu treten?
Ich bin ja kein Freund davon, irgendjemanden zu treten, egal ob Freund oder Gegner …
… na, dann sagen wir: Wollen Sie frischen Wind nach Berlin bringen?
Ich gehe – ohne naiv zu sein, dazu bin ich schon zu lange dabei – mit dem Wunsch und der Hoffnung in die Wahl, etwas bewegen und verändern zu können. Es ist ja nicht so, dass ich dahin will, weil ich hier nichts zu tun oder weil ich in meinen Unternehmen keine erfüllende Tätigkeit gefunden hätte. Ein Hinterbänkler möchte ich nun ganz bestimmt nicht sein. Man muss ja auch die Größe der Schritte, die die Regierungen in den letzten Jahrzehnten unternommen haben, differenziert betrachten – es gab große und kleine. Mir geht es darum, den Menschen vor den großen Schritten Mut zu machen; so ist auch das Bild mit dem Haus entstanden. Ich habe mal während eines Vortrags die Leute gefragt, wer denn in einem Haus aus den 50er-, 60-er Jahren wohnt, das waren die meisten. Und ich führte aus, dass man zwar immer hier etwas dran macht und dort etwas umbaut, aber irgendwann an den Punkt kommt, an dem ein großer Schritt nötig ist: Dann muss eine neue Heizung her, die Verkabelung muss neu verlegt werden oder ein neues Dach aufgesetzt. Und wenn dann die Handwerker kommen, bekommt man ein komisches Gefühl und fragt sich, ob man die Bude nicht lieber gleich verkaufen sollte, aber zieht es dennoch durch – es ist ja schließlich das Zuhause. Und genau an dem Punkt, an dem nur noch große Schritte helfen, sind wir jetzt: Die neue Verkabelung – das ist gewissermaßen dasselbe wie die neuen Stromtrassen, die gebaut werden müssen. Die neue Heizung – das ist die Energiewende im eigenen Haus. Der Umbau von Zimmern, etwa weil die Kinder aus dem Haus sind: die Reaktion auf den demografischen Wandel. Und ich fragte die Leute: Haben Sie das in Ihrem Haus denn hinbekommen? Die Antwort: Ja. Na, dann lassen Sie uns doch mit demselben Mut an die Herausforderungen der nächsten Jahre gehen, und uns nicht darüber ärgern, dass der neue Brenner zwar schon eingebaut ist, aber der Elektriker noch nicht da war, um ihn anzuschließen …
… ich habe gerade einen bestimmten Offshore-Windpark vor Augen.
Genau. Ich habe das Problem übrigens auch gerade zu Hause. Im Ernst: Wenn Probleme auftreten, muss man die auch klar ansprechen. Aber dieses selbstzerfleischende „Die Welt geht unter“-Lied, das Politiker so gerne singen und bei dem die Bürger das Gefühl bekommen, dass alles nur schlecht sei – dem möchte ich entgegenwirken. Ich möchte um Gotteswillen auch nichts banalisieren – wir stehen vor einem Mehrgenerationenprojekt, aber einem, bei dem wir den Luxus haben, es im Gegensatz zur Nachkriegsgeneration auf relativ hohem Niveau angehen zu können. Was aber zugleich das Problem nach sich zieht, dass man bei jedem Teil, das man verändert, schnell denkt: „Ach, so schlecht war das doch eigentlich alles gar nicht – können wir nicht lieber doch noch ein paar Kohlekraftwerke bauen und fertig?“ Oder diese unglückliche Diskussion über das Fracking: Wir haben doch längst die Entscheidung gefällt, dass fossile Brennstoffe nicht sinnvoll sind. Jetzt darauf zu setzen wäre etwa so, als würde man Weihnachten verschieben, um mehr Zeit zum Geschenke kaufen zu haben – das klappt nicht. Und wenn wir entschieden haben, auf Kreislaufprozesse zu setzen, dann müssen wir diesen Schritt auch konsequent gehen. Wenn man einen Zahn zieht, kann man das schnell oder langsam machen. Ich glaube, schnell ist besser.
Wo Sie gerade Energie ansprechen: Dieser Sektor ist neben der Landwirtschaft einer der großen Wirtschaftszweige in dieser Region. Nun findet sich auf Ihrer Website der Satz: „Nahrungsmittelproduktion muss immer Vorrang vor der Energieproduktion haben.“ Könnten Sie das etwas näher erläutern?
Ich meine damit die Konkurrenz um Flächen, wenn es um die Gewinnung von Bioenergie geht; Flächen, die dann nicht mehr für die Nahrungsmittelproduktion zur Verfügung stehen. Die Technologie der Biogasproduktion ist ja aus der Idee entstanden, dass man aus Bioabfall, der ohnehin entsteht, auch noch Energie gewinnen kann. Daraufhin hat man von Seiten der Politik angefangen zu wirken, Subventionen beschlossen und Wirtschaftsmodelle gefördert – was letztlich dazu geführt hat, dass der Bauer als Betriebswirt zu dem Schluss kommt, mit dieser und jener Pflanze könne er mehr Geld verdienen. Aber das ist ein künstlich erzeugtes Modell, und man muss sich fragen: Ist das eigentlich richtig? Hier bei uns im Haus kennen wir das Wort der Zweckgebundenheit von Technologie. Wie sagt unser Auditor immer so schön: „Ja, das Schiebedach Ihres Autos ist eine Möglichkeit, das Auto zu verlassen. Aber dazu ist es nicht gedacht. Es ist insofern eine schlechte Tür.“ Wenn wir jetzt den Menschen dafür Geld zahlen, dass sie ihre Autos durch das Dach verlassen, dann machen sie das, bekommen das Geld und äußern sich darüber, dass das doch eigentlich blöd ist. Also lassen Sie uns das Auto doch lieber wieder durch die Tür verlassen.
Die CDU kennt natürlich, wie alle anderen auch, innerparteiliche Auseinandersetzungen – im Moment aber scheint es so, als ob es erstmals regelrechte Flügelkämpfe gebe: Den einen wird die Partei zu sozialdemokratisch, die anderen fordern eben mehr soziale Politik ein, manche begannen sogar das Wort „Mindestlohn“ in den Mund zu nehmen. Wo innerhalb des Richtungsspektrums der Partei verorten Sie sich?
Ich bin von meiner Herkunft her Pragmatiker, und was ich überhaupt nicht mag, ist Ideologie. Ich möchte mich keinem Flügel zuordnen, weil ich dadurch die Flexibilität meines Denkens verlöre. Ich möchte die einzelnen Fragen lieber sachbezogen angehen. Als Naturwissenschaftler kann ich mir das erlauben, und ich halte es auch für die Politik für sinnvoll. Sie werden mich, je nach Fragestellung, auf beiden Flügeln wieder finden.
Die CDU wirbt – relativ ideologiefrei – mit Sprüchen wie „Mehr für Familien“, „Deutschland ist stark“ oder „Sichere Arbeit“. Hand aufs Herz: Das sind ja doch Worthülsen, in die man alles Mögliche hineininterpretieren kann. Meinen Sie nicht, dass der eine oder andere Aufstocker, prekär Beschäftigte oder Arbeitnehmer mit befristetem Vertrag – und hier bewegen wir uns bereits im Millionbereich – den Slogan „Sichere Arbeit“ eher als Hohn empfinden könnte?
Es ist ja die Frage, ob die Plakate das in der Vergangenheit erreichte beschreiben oder das, was man für die Zukunft in den Fokus rückt. Ich bin da ganz bei Ihnen: Ich finde es fürchterlich, auf Parolen reduziert zu werden; und wenn ich irgendwo spreche, gehe ich mit Freuden daran, sie mit Inhalten zu füllen. Wenn wir über „sichere Arbeit“ sprechen, dann geht es darum, gegen den Missbrauch sinnvoller Instrumente des Arbeitsmarkts vorzugehen – Stichwort Zeitarbeit. Dass diese feste Arbeitsverhältnisse ersetzt, war ja nicht intendiert; diese Schlupflöcher müssen sehr zügig geschlossen werden. Wir müssen Arbeit in zweierlei Hinsicht sicher machen: Zum einen in genereller Hinsicht, also den eingeschlagenen wirtschaftlichen Kurs weiterführen mit dem Ziel der Vollbeschäftigung. Das ist die Grundlage für die Rente, die Gesundheit, für Vieles. Zum anderen in individueller Hinsicht: Wir müssen sicherstellen, dass die Menschen von ihrer Arbeit leben und in vernünftigen Verhältnissen arbeiten können. Das eine bringt nicht viel ohne das andere: Es hilft nichts, wenn Menschen individuell sicherer gestellt sind, dafür aber weniger Menschen überhaupt Arbeit haben. Deshalb ist der Spruch „Sichere Arbeit“ vielleicht plakativ, aber dennoch nicht inhaltslos. Und daher plädiere ich auch für einen tariflichen, nicht gesetzlichen Mindestlohn: Den Sachverstand, den zu ermitteln, haben die Tarifparteien. Und wo es keine gibt, müssen wir dafür sorgen, dass beide Seiten an einen Tisch kommen. Ich halte starke Gewerkschaften daher für wichtig.
Die Arbeitgeber der Fleischbranche schienen ja lange Zeit kein gesteigertes Interesse an starken Gewerkschaften oder Tarifgesprächen zu haben, erst nach massiven Negativschlagzeilen scheint Bewegung in die Sache zu kommen. Was kann die Politik da tun?
Die Politik kann dafür sorgen, dass von Arbeitgebern und Arbeitnehmern Personen ausgewählt werden, die für ihre jeweilige Seite sprechen und sie an einen Tisch setzen. Es gibt diese Leute ja. Das Ergebnis kann die Politik dann für allgemeinverbindlich erklären. Ich möchte aber nicht, dass Volksvertreter dirigistisch eingreifen. Deswegen: Die Regeln vorgeben und dafür sorgen, dass die Hausaufgaben gemacht werden – aber nicht die Hausaufgaben für andere erledigen.
Zum Abschluss noch ein unmoralisches Angebot: Der Wahlkampf ist bislang sterbenslangweilig – das beklagen Leitartikler und Kabarettisten gleichermaßen. Daran wollen wir jetzt mal gemeinsam etwas ändern: Sie dürfen nun einem politischen Gegner Ihrer Wahl einen Vorwurf nach Ihrem Ermessen machen, und ich drucke das ab.
So nett dieses Angebot ist: Das tue ich nicht. Ich bin ganz am Anfang auf meine Mitbewerber zugegangen und habe ihnen gesagt, dass ich überhaupt keine Lust darauf habe, selbst besser anzukommen, indem ich sie schlecht mache. Man wird nicht deshalb gut, weil man sich als besser darstellt als andere. Und das finde ich an diesem Wahlkampf eigentlich ganz gut, dass das gar nicht so stattfindet, zumindest nicht von Seiten der CDU. Was wir den Menschen anbieten müssen, sind Lösungen, Ansätze, Visionen. Das mag dem einen oder anderen langweilig erscheinen, aber ich frage ganz ehrlich: Weshalb muss ein Wahlkampf denn Unterhaltungswert haben? Das ist die Arbeit der Kabarettisten.